Wissenswertes aus dem Gesundheitswesen: Nachrichten, Hintergründe, Interviews und mehr...
Branchenrelevante Informationen regelmäßig in Ihrem Postfach
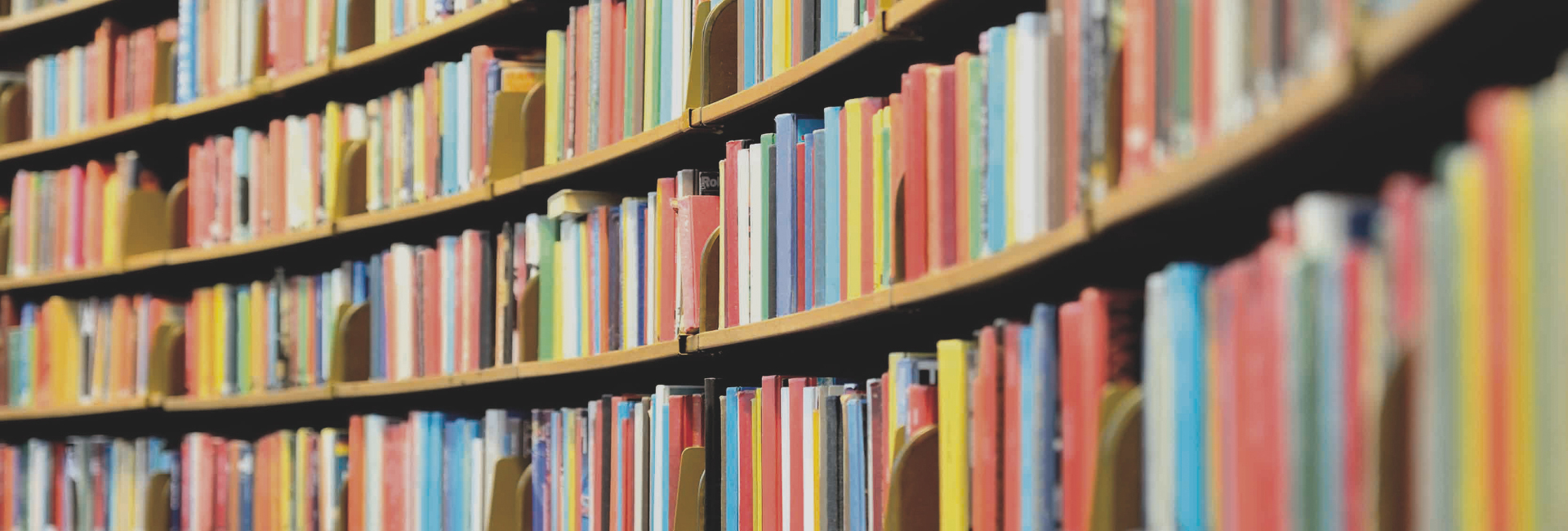
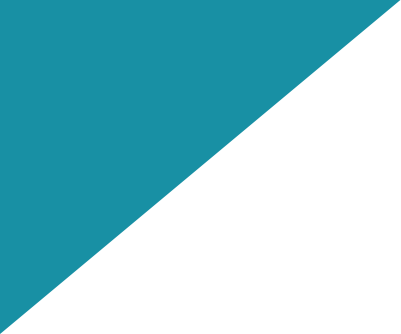

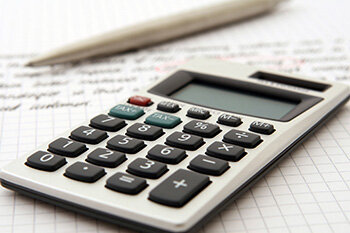

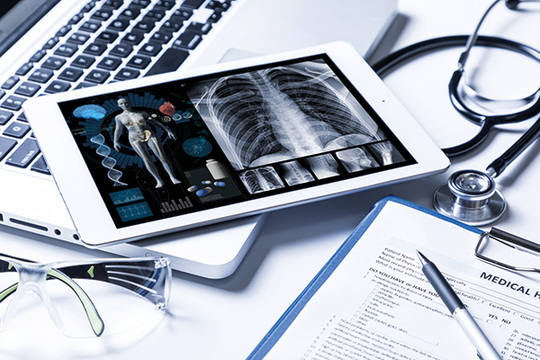



In dieser Podcast-Folge der medhochzwei Autorengespräche kommt Prof. Dr. Lars Timm, Professor der Hochschule Fresenius, zu Wort. Er leitet an der Hochschule den Fachbereich onlineplus des Studiengangs...