Wissenswertes aus dem Gesundheitswesen: Nachrichten, Hintergründe, Interviews und mehr...
Branchenrelevante Informationen regelmäßig in Ihrem Postfach

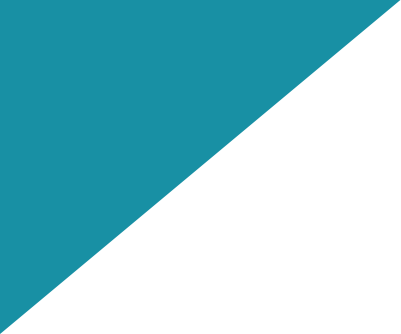


Der Entwurf des „Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Krankenhaus und zur Reform der Vergütungsstrukturen“ (Krankenhausverbesserungsgesetz, KHVVG) ist Mitte Mai vom Bundeskabinett beschlossen worden – mit einigen Änderungen, die zum Teil auch der noch nicht abgeschlossenen juristischen Prüfung des Entwurfs geschuldet sind. Laut des Bundesjustizministeriums (BMJ) wird rechtsförmliche und rechtssystematische Prüfung des Gesetzentwurfs fortgesetzt, die Zustimmung sei aufgrund der vom Bundesgesundheitsministerium vorgebrachten Eilbedürftigkeit erfolgt. Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach (SPD) hatte immer wieder betont, dass die verfassungsrechtliche Prüfung, ob das Gesetz zustimmungsfrei oder zustimmungspflichtig sei, sehr gründlich vorgenommen worden sei.
Einer der Punkte, der aus dem Entwurf verschwunden ist, ist die neu zu etablierende medizinisch-pflegerische Versorgung nach § 115h SGB V. Da diese neue Art der Versorgung laut des Entwurfs nur in den sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen vorgesehen sei, gebe es Bedenken mit Blick auf die Verfassungsmäßigkeit, sagte Lauterbach nach dem Kabinettsbeschluss. Daher sei sie aus dem Entwurf gestrichen worden. Die Hoffnung von Seiten des BMG ist wohl, dass die entsprechenden Regelungen nach abgeschlossener Prüfung im parlamentarischen Verfahren den Weg zurück ins Gesetz finden.
Auf die Forderungen der Länder und auch der anderen Kritiker des Entwurfs ist das Bundesgesundheitsministerium (BMG) mit der jetzt verabschiedeten Fassung des Entwurfs kaum eingegangen. Die Ziele der Reform wurden um die „Effizienzsteigerung“ erweitert – eine doch grundlegende Änderung gegenüber der ursprünglichen Zielsetzung. Im Referentenentwurf vom 13. März wurden „Sicherung und Steigerung der Behandlungsqualität, Gewährleistung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung für Patientinnen und Patienten sowie Entbürokratisierung“ als die drei zentralen Ziele genannt – im Kabinettsentwurf sind es jetzt vier Ziele – die „Steigerung der Effizienz in der Krankenhausversorgung“ wird noch vor der Entbürokratisierung genannt.
In einem Anhang des Kabinettsentwurfs werden jetzt, abweichend zum Referentenentwurf, die Qualitätskriterien zu den 65 zum Start vorgesehenen Leistungsgruppen beschrieben, die die Krankenhäuser erfüllen müssen, um die jeweilige Leistungsgruppe erbringen zu dürfen. Zu diesen Qualitätskriterien gehören die personelle und die sachliche Ausstattung sowie die erforderliche Erbringung verwandter Leistungsgruppen entweder am Standort oder ggf. über eine Kooperation. Zusätzlich sind sonstige Struktur- und Prozesskriterien hinterlegt, wie zum Beispiel die Erfüllung der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PpUGV), die Erfüllung der Voraussetzungen der erweiterten Notfallstufe oder die konsiliarische Erreichbarkeit bestimmter Dienste.
Auch weitere Möglichkeiten zur Regelung über Rechtsverordnungen werden dem BMG mit dem Kabinettsentwurf gegeben, unter anderem soll das Ministerium mit Zustimmung des Bundesrates Regelungen treffen können, die Verträge mit Leistungserbringern der vertragsärztlichen Versorgung oder Krankenhäusern betreffen. Im Referentenentwurf war bereits vorgesehen, dass das Ministerium per Ersatzvornahme Regelungen die Zulässigkeit der Einhaltung der Qualitätskriterien von Leistungsgruppen in Kooperationen und Verbünden betreffend erlassen kann.
Zu den Rechtsverordnungen zur Weiterentwicklung der Leistungsgruppen sowie zur genauen Ausgestaltung der Modalitäten zur Verteilung der Mittel aus dem Transformationsfonds sagte Lauterbach, diese seien im Interesse der Länder, daher sei dort keine Verzögerung zu erwarten. Vorgesehen sei, diese Rechtsverordnungen im Frühjahr 2025 zu beschließen.
Der geplante Ausschuss zur Weiterentwicklung der Leistungsgruppen und deren Kriterien soll nun neben Vertretern des GKV-Spitzenverbands, der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), der Bundesärztekammer (BÄK) und der Berufsorganisationen der Pflege zusätzlich mit Vertretern der Hochschulmedizin besetzt werden.
Basis der Mindestvorhaltezahlen konkretisiert
Die Basis für die Mindestvorhaltezahlen, an die die Auszahlung der Vorhaltevergütung geknüpft werden soll, wird in dem beschlossenen Entwurf konkretisiert. Dazu sollen die Fallzahlen des vorvergangenen Jahres genutzt werden. Wird eine Leistungsgruppe durch die Planung der Länder an einem Standort konzentriert, so sollen analog zur beschriebenen Regelung die Zahlen des vorvergangenen Jahres der Standorte, an denen die LG erbracht wurde, zusammengenommen die Mindestvorhaltezahl erfüllen, damit die LG zugeteilt werden kann. Das gilt sowohl für Standorte verschiedener Träger als auch mehrere Standorte eines Trägers.
Die maßgeblichen Vorhaltezahlen für die Leistungsgruppen soll das Ministerium auch per Rechtsverordnung festlegen können, erarbeitet auf Grundlage einer Empfehlung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG).
Mit Blick auf das Wettbewerbsrecht soll ein neuer Passus im KHVVG verhindern, dass ein durch Mittel aus dem Transformationsfonds geförderter Zusammenschluss wettbewerbsrechtlich angreifbar wird. Die nötigen Anpassungen sollen im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen gemacht werden.
Zu den Regelungen zum Transformationsfonds (§12b KHG), laut derer die Umsetzung des zu fördernden Vorhabens am 1. Januar 2026 noch nicht begonnen haben darf, sagte Lauterbach, dass Umstrukturierungsvorhaben auch im Moment und bis Ende 2025 noch aus dem Strukturfonds gefördert werden können. Dieser verfügt im Moment noch über mehr als einer Milliarde Euro an Fördermitteln.
Auf die Frage nach der Kritik an der vorgesehenen Finanzierung des Transformationsfonds (Hälfte GKV, Hälfte Länder) sagte Lauterbach, die Einsparungen und Kostensenkungen würden ja auch bei den Versicherten ankommen, daher sei die hälftige Finanzierung durch die Kassen richtig. Er ergänzte: „Hätten wir das alles aus Steuermittel bezahlt, wäre die Versuchung groß gewesen, dass wir damit einfach laufende Defizite ausgeglichen hätten, und wir hätten gar keine richtige Strukturreform bekommen. Das musste auf jeden Fall vermieden werden!“
Die nächste Bund-Länder-Runde zur Krankenhausreform soll ca. zwei Wochen nach Kabinettsbeschluss, also Ende Mai, stattfinden. Die erste Lesung im Bundestag soll noch vor der Sommerpause, die 2./3. Lesung im Herbst stattfinden.
Kritik von vielen Seiten
Kritik am jetzt erfolgten Beschluss kommt von verschiedensten Seiten. Neu ist die Kritik des Bundesrechnungshofs, die in einem 26-seitigen Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung zum Ausdruck kommt. Die dort aufgezeigten Schwächen sind unter anderem der Transformationsfonds bzw. seine vorgesehene Finanzierung und die Systematik der Berechnung der Vorhaltepauschalen. Auch die Verteilung der Mittel aus dem Transformationsfonds nach dem Königsteiner Schlüssel sei „nicht sachgerecht“, heißt es in dem Gutachten. Empfohlen wird, versorgungsspezifische Indikatoren wie z. B. Morbidität, Demographie und den Investitionsbedarf der Krankenhäuser bei der Mittelverteilung zu berücksichtigen.
Zu den geplanten Leistungsgruppen und den zugehörigen Qualitätskriterien heißt es, man begrüße grundsätzlich, einheitliche Qualitätskriterien als Grundlage einer Behandlung im Krankenhaus festzulegen. Ob allerdings die Leistungsgruppen tatsächlich zu einer Konzentration von Leistungen auf bestimmte Krankenhäuser, Spezialisierung und damit Qualitätssteigerung führen würden, lasse sich nicht ausreichend vorhersagen. Um eine Ballung der qualitativ guten Krankenhäuser nur im urbanen Raum zu vermeiden, sollte das BMG die Auswirkungen der geplanten Regelungen analysieren.
Ein weiterer Hinweis im Gutachten beschäftigt sich mit der landeshoheitlichen Krankenhausplanung. Die Wirklichkeit und Notwendigkeit stationärer Versorgung richte sich nicht nach Ländergrenzen, so der Bundesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung. Er regt an zu prüfen, ob ein größerer Anteil der Mittel aus dem Transformationsfonds als die derzeit vorgesehenen fünf Prozent für länderübergreifende Vorhaben bereitgestellt werden könne.
Abschließend wird auch die Schätzung zu Minderausgaben der GKV kritisiert – es sei nicht zu erkennen, welche konkreten Annahmen den genannten Minderausgaben zugrunde liegen würden. Die ab dem Jahr 2027 auf mindestens vier Milliarden Euro jährlich bezifferte Mehrbelastung für die GKV entspräche einer Steigerung des Zusatzbeitragssatzes um mehr als 0,2 Prozentpunkte. „Der Bundesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung hält das für problematisch. Die Zusatzbeitragssätze sind in den vergangenen Jahren bereits deutlich angestiegen. Insgesamt würde die strukturelle Deckungslücke zwischen den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds und den Ausgaben der Krankenkassen erheblich verstärkt.“
DKG: Entwurf erfüllt selbstgesteckte Ziele nicht
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft wies nach dem Kabinettsbeschluss erneut darauf hin, dass der nun verabschiedete Entwurf die selbst gesteckten Ziele nicht erfülle, was auch zu einer massiven Kritik der Bundesländer in deren Stellungnahme geführt habe. „Mehr ambulante Behandlungsmöglichkeiten am Krankenhaus, mehr Spezialisierung bei komplexen Leistungen, gesicherte Patientenversorgung in der Fläche, auskömmliche und leistungsunabhängige Strukturfinanzierung sowie deutliche Entbürokratisierung wurden uns allen über Monate hinweg versprochen und wortreich angekündigt“, so der DKG-Vorstandsvorsitzende Dr. Gerald Gaß. Auch die jüngste Verschiebung der Abstimmung im Kabinett habe der Gesundheitsminister nicht genutzt, um noch einmal wesentlich nachzubessern und das Gesetz praxistauglich zu machen. „Nur inhaltlich marginale Änderungen hat das Ministerium vorgenommen und damit gezeigt, dass es berechtigte Kritik, ob von Länderseite, den Krankenkassen, den Kliniken oder den Kommunen und Landkreisen, schlicht und ergreifend ignoriert.“ Die Reform sei so versorgungsgefährdend, dass alle Bundesländer inklusive der SPD-geführten die Pläne des Parteikollegen in einer gemeinsamen Stellungnahme ablehnen würden.
Die Reform müsse zu den Kompromissen zwischen Bund und Ländern zurückkehren, das Leistungsgruppenmodell nach NRW-Vorbild einführen und eine tatsächlich fallzahlunabhängige Strukturkostenfinanzierung einführen, fordert die DKG.
Auch der Marburger Bund (MB) kritisierte den KHVVG-Entwurf nach dem Beschluss erneut. Der Gesetzentwurf zur Krankenhausreform kranke an mehreren Webfehlern, so die 1. Vorsitzende des MB, Dr. Susanne Johna. Die Vorhaltefinanzierung entpuppe sich als Etikettenschwindel, weder die Verteilung der Vorhaltefinanzierung noch die Auszahlung an die Krankenhäuser sei fallunabhängig gestaltet. Der Verband befürchtet auch Engpässe bei der ärztlichen Aus- und Weiterbildung.
Der Verband der Universitätsklinika Deutschlands (VUD) begrüßte den Beschluss als „wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer zukunftsfesten Versorgung“. Der 1. Vorsitzende des VUD, Prof. Jens Scholz, sagte, die Herausforderungen seien sehr groß, aber mit dem Beschluss würden die Krankenhäuser und alle anderen Beteiligten das klare Signal erhalten, dass es den dringend benötigen Strukturwandel geben muss und dass finanzielle Unterstützung bereitgestellt wird. „Das verleiht dem großen Vorhaben Krankenhausreform kräftigen Rückenwind.“
Jens Bussmann, Generalsekretär des VUD, betonte die Bedeutung der im Entwurf vorgesehenen Koordinierungsfunktion. „Jetzt kann begonnen werden, regionale Patientenpfade gemeinsam zu gestalten, um die Patientinnen und Patienten in das richtige Behandlungssetting zu steuern. Dies ist ein wichtiger Beitrag, um die regionalen Versorgungskapazitäten bestmöglich nutzen zu können. Hierfür brauchen wir auch neue verbindliche Spielregeln und Aufnahmepflichten, gerade wenn es um die Verlegung zwischen Kliniken geht“.
Die Vorstände der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Dres. Andreas Gassen, Stephan Hofmeister und Sibylle Steiner sagten in einer ersten Stellungnahme, es sei höchst bedauerlich und auch nicht hinnehmbar, dass die ohnehin bestehenden Wettbewerbsnachteile des ambulanten Bereichs gegenüber den Krankenhäusern noch einmal verschärft werden sollen. Der Entwurf verstoße gegen Regelungen zum EU-Beihilferecht, weil er erneut eine finanzielle Förderung ausschließlich der Krankenhäuser vorsehe. Man habe diese Frage begutachten lassen und sei bestätigt worden. „Wir werden uns deshalb nun an die Europäische Kommission wenden mit der Bitte zu prüfen, ob eine mutmaßliche Beihilfeverletzung vorliegt. Damit folgen wir auch einem Auftrag unserer Vertreterversammlung. Der viel apostrophierte Wettbewerb der gleich langen Spieße darf kein Trugbild sein, sondern muss endlich Realität werden.“
BMC: Leistungskonzentration ist notwendig
Der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Managemd Care (BMC), Prof. Dr. Lutz Hager, sagte anlässlich der Verabschiedung des Entwurfs: „Eine am Bedarf und auf Qualität hin ausgerichtete Konzentration von Leistungen und Standorten, wie sie die Krankenhaushausreform anstrebt, ist notwendig. Gesundheitsversorgung der Zukunft benötigt aber mehr: eine kooperativ vernetzte, digital unterstützte und ambulant-stationär integrierte Versorgung jenseits der Sektoren. Es ist ein großes Versäumnis, dass die Krankenhausreform sektorales Denken fortschreibt und zukunftsgerichtete Impulse vermissen lässt. Die neuen sektorenübergreifenden Einrichtungen blenden ambulante Strukturen aus; Koordination und telemedizinische Zusammenarbeit bleibt auf Krankenhäuser beschränkt; Steuerungsinstrumente, die den Zugang von Patient:innen zur Versorgung optimieren, fehlen völlig. Zu allem Überfluss schafft das Gesetz statt versprochener Entlastungen unzählige bürokratische Anforderungen sowie Unsicherheiten durch noch kaum absehbare Auswirkungen auf die Finanzierung. Beides wird die Kliniken auf Jahre belasten.“
DBfK: Reform kommt ohne Pflegequalität nicht aus
Auch der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) zeigte sich nach dem Kabinettsbeschluss enttäuscht. Dr. Bernadette Klapper, DBfK-Bundesgeschäftsführerin, sagte: „Eine Reform der Krankenhausversorgung ist dringend nötig und sie darf nicht isoliert angegangen werden. Wenn wir erfolgreich die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherstellen wollen, muss die Bundesregierung mit der Krankenhausreform die richtigen Weichen stellen. Das heißt, Pflegequalität muss ein Kriterium für die Zuordnung zu Leistungsgruppen sein. Eine Klinik, die Spitzenmedizin leisten will, kommt ohne hohe Pflegequalität nicht aus.“ Sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen, die unter pflegerischer Leitung stehen können, werden notwendig, insbesondere um älteren, multimorbiden Patientinnen und Patienten Tage der Rekonvaleszenz ermöglichen zu können. Im aktuellen Entwurf seien aber sämtliche Regelungen, die das Potenzial pflegerischer Kompetenzen gehoben und die Autonomie der Pflegefachpersonen gefördert hätten, gestrichen worden. „Das Gesetz in dieser Form ist ein Bärendienst für eine erfolgreiche Reform der Gesundheitsversorgung in Deutschland und nutzt die Potenziale der professionellen Pflege nicht“, so Klapper.
Auch von Seiten der Psychotherapie kam Kritik: Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) merkte an, dass im beschlossenen Entwurf die stationäre Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen unberücksichtigt bleibe. Man werte das als vertane Chance, denn seit Jahren sei bekannt, dass die Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik nicht ausreiche, um eine leitliniengerechte Versorgung der Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. „Die Klinikreform muss genutzt werden, um die Behandlungsqualität in der stationären Versorgung auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen zu steigern. Mehr Personal sichert eine leitliniengerechte Versorgung, die zu besseren Behandlungsergebnissen führt“, so BPtK-Präsidentin Dr. Andrea Benecke. „Deshalb fordert die BPtK, dass in der PPP-Richtlinie Qualitätsvorgaben für eine leitliniengerechte Behandlung ergänzt werden.” Auch um die psychotherapeutische Weiterbildung anbieten zu können, brauche man die gesetzlich verbriefte Sicherheit, zusätzliche Personalstellen für die Weiterbildung refinanziert zu bekommen, so Benecke.
Dieser Beitrag stammt aus dem medhochzwei Newsletter 09-2024. Abonnieren Sie hier kostenlos, um keine News aus der Branche mehr zu verpassen!